Peter Turrini: „Wir sind alle eine Abweichung, jeder auf seine Art“
Peter Turrini gab uns eines seiner seltenen Interviews. Ein Gespräch über seine zwei neuen Stücke und jene Dinge, die ihn noch immer wütend machen: Fremdenhass, Dummheit, politische Leerversprechungen und die „Normalitäts“-Debatte.

Foto: Moritz Schell
Ein Telefonat mit Peter Turrini. Wir besprechen noch einmal das Interview, das er mit uns geführt hat – er hat noch ein paar Anmerkungen, und wir bedanken uns für seine Zeit.
Bei der Verabschiedung machen wir ihm noch ein Angebot: „Wenn Sie irgendwas brauchen, rufen Sie einfach an.“
Antwort Peter Turrini: „Passt. Mach ich. Wenn ich gestorben bin, melde ich mich, dann habt ihr eure Story.“
BÜHNE: „Super. Ich werde abheben.“
Turrini (lachend): „Das wäre blöd, weil dann machen Sie mir die ganze Geschichte kaputt.“
79 Jahre ist Peter Turrini, Österreichs großer Wortkünstler, im September geworden, und er schreibt weiter und weiter. Im November hatte „Bis nächsten Freitag“ (Erwin Steinhauer und Herbert Föttinger) in der Josefstadt Premiere, am 11. Jänner nun sein nächstes Stück „Es muss geschieden sein“. Es ist eine Koproduktion mit den Raimundspielen Gutenstein – für Wien hat es Peter Turrini noch einmal neu überarbeitet.
Sie sind ein großer Menschen-beobachter …
Ja. Das hängt vermutlich mit Ängsten aus meiner Kindheit zusammen. Ich bin in einem Kärntner Dorf in der Nachkriegszeit als Sohn eines Italieners aufgewachsen und fühlte mich sehr fremd. Ich habe die Menschen meiner Umgebung beobachtet und Sätze vorbereitet für den Fall, dass wieder einmal einer fragt, warum ich einen ausländischen Namen habe. Leider sind meine Antworten nie ausgesprochen worden, sondern in meinem Kopf geblieben.
Und heute?
Meine Methode hat sich nicht grundsätzlich geändert. Nach wie vor beobachte ich Menschen und mache mir Notizen. Über ihre Sprache, über ihre Erscheinung, über ihre Eigenheiten. In meinem Archiv in Kleinriedenthal stapeln sich diese Beobachtungen. Einige meiner Vorfindungen gehen in meine Stücke ein, ich verwickle sie in dramatische Vorgänge. Aus Vorfindungen werden Erfindungen. Da vermischen sich die Realität und die Fantasie. Aber ich muss an der menschlichen Erscheinung Maß nehmen, sonst hätte ich gar nicht den Mut zum Schreiben.
Wie sehr haben Sie bei dem Stück „Bis nächsten Freitag“ sich selbst beobachtet?
Natürlich nehme ich mich von dieser Archäologie der menschlichen Seele nicht aus. Ich habe ein ziemliches Naheverhältnis zum Abgrund. Aber wenn es mir gelingt, mich mit Wortbrücken über diesen Abgrund hinwegzuretten, dann bin ich für eine Weile sehr glücklich. Außerdem gibt es ein paar Menschen, für die ich mich verantwortlich fühle, und so etwas reduziert auch die Absturzgefahr.

Foto: Moritz Schell
Beim Lesen von „Bis nächsten Freitag“ hat man die ganze Zeit die Stimmen von Steinhauer und Föttinger im Kopf.
Nachdem ich die Grundgeschichte dieses Stückes in meinem Kopf hatte, habe ich Herbert Föttinger davon erzählt und meinen Wunsch geäußert, dass er und Steinhauer die Hauptrollen spielen sollten. Der Wunsch ist dann auch in Erfüllung gegangen. Beim zweijährigen Schreiben des Stückes sind die beiden wie zwei freundliche Avatare neben meinem Schreibtisch gestanden. Das hat mich nicht gestört, eher beflügelt. Als ich mit dem Stück fertig war, habe ich mit den beiden ausgiebig darüber diskutiert. Als Regisseur habe ich Alexander Kubelka vorgeschlagen, der ja schon meine Stücke „Josef und Maria“ und „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ in den Kammerspielen inszeniert hat. Sein theatralischer Fieberkopf gleicht dem meinen: Da mischt sich Vorfindung mit Erfindung, Realistisches mit Fantastischem.
Warum schreiben Sie so gern für Herbert Föttinger?
Herbert Föttinger hat das Theater der Josefstadt mit Ur- und Erstaufführungen aus seinen eingerosteten Angeln gehoben. Das finde ich eine großartige Leistung. Außerdem gibt es eine Reihe von Leuten im Haus, die ich einfach gern habe: in den Büros, in der Technik, bis zum Kantinenwirt. Ich brauche diese Art von Zugehörigkeit. In den Neunzigerjahren war dies bei Peymann im Burgtheater der Fall, und seit fast zwanzig Jahren sind die Josefstädter meine Theaterfamilie. Ich bin ein anhänglicher Mensch.
In Ihren beiden neuen Stücken „Bis nächsten Freitag“ und „Es muss geschieden sein“ geht es um Menschen, die das Leben aus der Bahn wirft und radikalisiert. Haben Sie Angst, dass das schnell geht?
Das geht nicht schnell, das ist ständig da. So viele Fertigkeiten können Sie gar nicht erwerben, dass Sie nicht demnächst überflüssig werden. So viele Follower können Sie gar nicht versammeln, dass Sie morgen nicht allein dastehen. Die Bedeutungen, die man sich zumisst, und die Auszeichnungen, die man auf sich häufelt, halten nicht länger als ein reifer Kürbis in der Sonne. Herr Benko kann die Zentrale seiner Holding mit noch so viel Gold und Marmor verkleiden, die Bude bricht dennoch zusammen und begräbt die Arbeiter und Angestellten unter sich. Ich will hier nicht den Unterganghofer spielen, aber dass uns die Welt täglich unter den Füßen wegbricht, ist keine apokalyptische Prophezeiung, sondern ein nachweislicher Vorgang.
Wer ständig durch die Schießscharten seiner Festung schaut, hat einen verengten Blick.
Warum haben auf die allgemeine Verunsicherung offenbar nur die rechten Parteien massentaugliche Antworten?
Sie haben gar keine Antworten. Sie haben nur falsche Versprechungen. Dass hier das Glück einzieht, wenn alle Ausländer weg sind, wer kann denn so was glauben? Aber offensichtlich geht es vielen Leuten so schlecht, dass sie darauf hereinfallen.
Was denken Sie, wenn Sie Herbert Kickl sagen hören, „Das ist erst der Anfang“?
Der Anfang von was? Noch mehr Grauslichkeiten gegen Flüchtlinge? Beugehaft für kritische Journalisten? Alle Literatinnen und Literaten einsperren, die nicht so schlecht reimen können wie Herr Kickl? Wer ständig durch die Schießscharten seiner Festung schaut, hat einen verengten Blick. Ich halte diesen Jedi-Ritter mit der Fistelstimme nur schwer aus.
Wie kriegt man den Fremdenhass wieder weg?
So wie es derzeit aussieht, gar nicht. Denn das Fremde, das vielen so hassenswert erscheint, liegt in uns selbst. Wir sind uns selbst fremd geworden. Den „echten Österreicher“ gibt es nicht. Wir sind ein europäisches Gemisch gleichen Namens, ein Pinscher, der sich beizeiten die Ohren eines Schäferhundes aufsetzt und großdeutsch bellt. Selbst der Ötzi, der Urtiroler, stammt nicht aus den tirolischen, sondern aus den anatolischen Bergen.
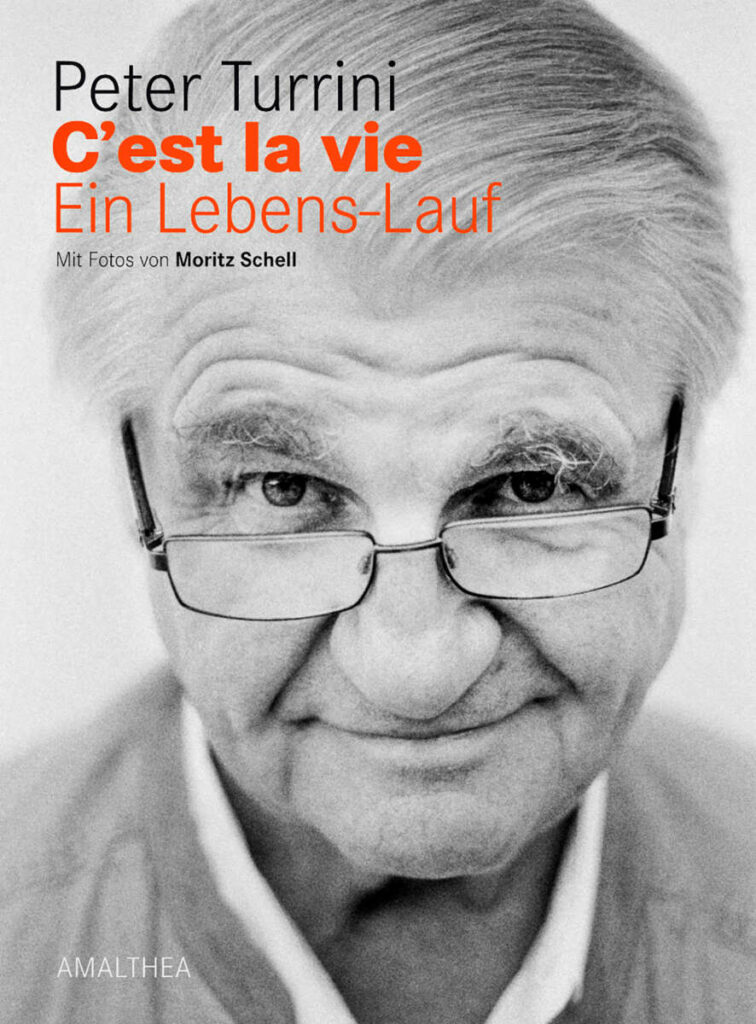
Foto: Moritz Schell
Sie leben schon recht lange in Niederösterreich. Sind Sie so „normal“, wie Ihre Landespolitik Sie haben möchte?
Die Menschen ähneln einander, vor allem in einem Punkt: Niemand ist normal. Ich habe noch nie einen normalen Niederösterreicher getroffen. Wir alle sind eine Abweichung, jeder auf seine Art. Und diejenigen, die ununterbrochen die Normalität einfordern, sind die größten Abweichler. Oder halten Sie ein persisches Emigrantenkind, das mit Lederhose und einem NS-Gesangsbuch durch die Gegend rennt, für normal?
Sie wurden für Ihre „lebenslange Wachsamkeit und den Mut zur Unbequemlichkeit“ ausgezeichnet. Was löst dieses Lob in Ihnen aus?
Sie meinen den Axel-Corti-Preis? Über den habe ich mich gefreut. Vor Jahrzehnten haben der Wilhelm Pevny und ich einen Film mit Corti gemacht. Der ORF wollte den Film abwürgen. Von der Würgung zur Würdigung, von der Halsumschließung zur Schulterklopferei – ich bleibe vorsichtig. In unserer politischen Zukunft könnte es ja passieren, dass die Hand von der Schulter wieder zurück zum Hals wandert.
Wie kriegt man die Gesellschaft wieder ein wenig entspannter?
Ich mache den Lesern der Bühne einen Vorschlag: Wenn das nächste Mal ein dunkelhaariger Paketbote an Ihrer Tür läutet und Sie in schlechtem Deutsch bittet, ob er auf Ihr WC gehen darf, dann denken Sie nicht gleich an einen Neffen- oder Nichtentrick oder an einen Räuber, der Ihre Preziosen auskundschaften will, sondern an einen Menschen, der dringend aufs Häusl muss. Er wird es Ihnen mit einem entspannten Blick danken.
Was sagen Sie jenen, die Theater für Luxus halten?
Dass sie vollkommen recht haben. Aber im Unterschied zu einer sündteuren Perlenkette hat man nachher nicht Lametta um den Hals, sondern Einsichten im Kopf. Und im besten Fall sogar Freude im Herzen.
Wie sehr spornt Sie Ihre Krankheit an, weiterzuschreiben?
Meine Krankheit ist da, aber sie interessiert mich nicht den ganzen Tag. Ich will und ich muss schreiben, das ist mein Überlebensmittel. Und wenn ich schwach werde, vom Pegasus rutsche und nicht weiterweiß, dann hilft mir meine Liebste, die Silke Hassler, zurück in den Sattel.
Zur Person: Peter Turrini
geboren 1944 in St. Margarethen im Lavanttal, wuchs in Maria Saal auf und war von 1963 bis 1971 in verschiedenen Berufen tätig. Seit 1971 freier Schriftsteller, lebt in Kleinriedenthal bei Retz. Turrinis Werke wurden in über dreißig Sprachen übersetzt, seine Stücke werden weltweit gespielt. Seine zwei neuen: „Bis nächsten Freitag“ (seit November) und „Es muss geschieden sein“ (Premiere: 11. Jänner), beide Josefstadt.




